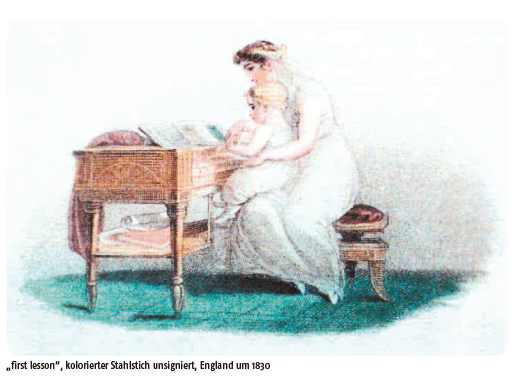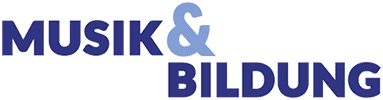Wunder – Kinder – Schinder?
Jürgen Oberschmidt
Wahre Geschichten über die Ware „Wunder“
„Wahre Wunder sind so selten, dass man davon spricht, wenn man einmal eins erlebt hat. Ein Kapellmeister aus Salzburg mit Namen Mozart ist hier kürzlich mit zwei Kindern von allerliebstem Anblick eingetroffen. Seine elfjährige Tochter spielt hinreißend Klavier. […] Ihr Bruder, der im nächsten Februar sieben Jahre alt wird, ist so ein ungewöhnliches Wunderkind, dass man kaum glauben kann, was man mit seinen Augen sieht und mit seinen Ohren hört. […] Auf der Klaviatur ist er so sicher, dass er, wenn man sie mit einem Tuch zudeckt, auf dem Tuch mit derselben Schnelligkeit und Genauigkeit spielt. Mühelos liest er alle Noten, die man ihm vorlegt; er komponiert mit wunderbarer Leichtigkeit, ohne zum Klavier gehen und seine Akkorde suchen zu müssen. Ich habe ihm eigenhändig ein Menuett aufgeschrieben und ihn gebeten, den Bass darunter zu setzen, das Kind griff zur Feder und setzte, ohne zum Klavier zu gehen, den Bass unter mein Menuett. […] Dieses Kind wird mich bestimmt noch närrisch machen, wenn ich es öfters höre; es zeigt mir, wie schwer es ist, sich vor Tollheit zu hüten, wenn man Wunder erlebt“ (zit. n. Klose 1991, S. 15f.).
So berichtet der Schriftsteller und Diplomat Melchior Grimm in seiner Kritischen Korrespondenz am 1. Dezember 1763 aus der Pariser Gesellschaft über den legendären Auftritt von Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, der sich selbst lieber Wolfgang Amadé nannte und bis heute immer noch als Inbegriff eines genialen Wunderkindes gilt: Ein Vorbild für viele andere Künstler – oder eher für deren Eltern, inklusive aller Tennisväter und Eislaufmütter.
In literarischen Texten diente der Begriff „Wunderkind“ zunächst zur Bezeichnung des wunderbar geborenen Jesus, so lesen wir es bei Novalis und im berühmten, 1854 begonnenen Wörterbuch der Gebrüder Grimm: „Seit dem späten 16. Jh. ein Kind übernatürlicher Herkunft und Artung, im Sprachgebrauch der Religion und des Mythos. Als eine bes. in der erbaulichen Sprache des 17. u. 18. Jhs. sehr geläufige Bezeichnung für Christus als Kind, den Jesusknaben“ (Bd. 30, Sp. 1893).
Im Lateinischen wurde der Begriff Mirakel (miraculum, „Wunderding“) für jene Phänomene verwendet, die ein sensationslustiges Publikum zu unterhalten wussten. Hierzu gehört das geschilderte Zudecken der Klaviatur mit einem Tuch, was eher an Kunststücke in einer Zirkusarena als an seriöse Konzertauftritte erinnert. Derlei weltliche „Mirakelberichte“ ähneln immer wieder jenen der Heiligenlegenden: Mit dem Begriff „Wunder“ werden all jene Ereignisse erfasst, die dem Eingreifen einer Gottheit oder metaphysischen Kraft zugeschrieben werden, das gilt auch für jene Beschreibung des „wunderbaren“ Wolfgang Amadé Mozart. Für die späteren Ohren des 19. Jahrhunderts war der Musiker kein Handwerker mehr, sondern ein Genie mit gottähnlicher Schöpferkraft und bis heute kommen Heilungsuchende Konzertpilger in die Tempel der Musen, um hier zu erleben, wie in einer heiligen Wandlung der in einer Partitur geborgene göttliche Funke unter den Händen eines Meis ters in ebensolch geheiligte Klänge transformiert wird. Das geschieht nicht in spärlichen Abonnementskonzerten, sondern vornehmlich auf herausgehobenen Festspielen, die zudem himmlische Exklusivität versprechen. Die wallfahrenden Hörer nehmen dabei eine Haltung ein, die der Kunst und dem Künstler eine quasi religiöse Rolle eines Musikgurus oder Kunstgottes zuzuweisen sucht: „Der Taktstock wurde zum Zauberstab über die Massen, aus seinen Zuhörern seine Gemeinde, aus Zuhören Andacht – so feierte Herbert von Karajan bei jedem Erscheinen ein tönendes Hochamt“ (Umbach 1993, S. 36).
Neue Definitionsversuche
„Ein Wunderkind ist jemand, der schon mit sechs so unbegabt ist wie andere erst mit sechzig“ (zit.n. Kunze 2016, S. 11). So markierte Arnold Schönberg mit bissigem Blick auf seinen Konkurrenten Erich Wolfgang Korngold den Terminus „Wunderkind.“ Der Musikkritiker Paul Bekker kann sich bei seinem Blick auf Korngold einen ähnlich kritischen Seitenhieb nicht verkneifen: „Zu oft haben wir erlebt, dass die schönsten Knospen verdorren, weil sie von unbedachten und eitlen Pflegern zu früh ans Licht gezerrt wurden“ (ebd. S. 77). Im Zuge dieser Säkularisierungstendenzen geraten zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer wieder auch die Auswirkungen frühkindlicher Höchstleistungen auf Körper und Psyche in den Blick. Das gilt auch für das erste namentlich bekannte Wunderkind der Geschichte, das universelle Fähigkeitsbündel Christian Heinrich Heineken (1721–1725), der als dreijähriger Rechenkünstler und Sprachgenie u. a. eine Geschichte Dänemarks schrieb und der – wie wir heute vermuten – an Zöliakie starb, und dessen kurzes Leben mit ähnlichen Metaphern beschrieben wurde: „Fructus esse idem diuturnus ac praecox nequit.“ (Eine Frucht, die vor ihrer Zeit gereift ist, kann nicht lange Bestand haben.“) Und Immanuel Kant war es, der Heineken als „frühkluges Wunderkind“ bezeichnete, „Abschweifungen der Natur von ihrer Regel“ diag nostizierte und damit einen allerersten Definitionsversuch dieser „Raritäten fürs Naturalienkabinett“ (Kant 1977, S. 547) wagte. Wunderkinder haben die Öffentlichkeit von der zweiten Hälfte des 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert beschäftigt und wenn heute auch jeder diesen Begriff kennt und verwendet, genießt dieser keinen guten Leumund mehr. Er gilt als ideologisch überfrachtet. Heute spricht man daher etwas nüchterner von „Hochbegabten“, die mit diesem neuen Etikett auch den Zauber des Unerklärlich-Wundersamen verloren haben. Anders als im 19. Jahrhundert hat Kinderarbeit im öffentlichen Musikleben heute keinen Platz mehr, frühreifende Höchstleistungen vornehmlich fernöstlicher Wunderkindmanufakturen werden allenfalls in den exhibitionistischen YouTube-Kanälen präsentiert, daher erübrigt sich auch scheinbar eine Diskussion dieses Begriffs. Auch über das zulässige Höchstalter von Wunderkindern lassen sich kaum verbindliche Angaben machen. Der damals zwanzigjährige und damit nicht mehr ganz junge Basketballer Dirk Nowitzki wurde bei den Dallas Mawericks als „German Wunderkind“ eingeführt. Beethoven unterlag lediglich der freiwilligen Selbstkontrolle eines Vaters, der seinen Sohn anlässlich der ersten und letzten Präsentation als Wunderkind im März 1778 als „kleinen Sechsjährigen“ angekündigt und ihn durch einen im Zusammenhang mit Wunderkindern häufig vorkommenden Rechenfehler erst einmal um ein Jahr jünger gemacht hat.
Über Alleinerziehende Väter
„Geb. 1818 in Leipzig, einzig und allein von ihrem Vater gebildet, entwickelte C. W. [Clara Wieck] bereits in ihrem 12. Jahre eine so große Virtuosität auf dem Klavier, dass sie schon damals mit Recht in die Schranken der Künstler trat“ (Becker 1838, S. 430). Leopold Mozart und Friedrich Weck stehen an der Spitze einer großen Tradition Alleinerziehender Väter, denen sich dann im 20. Jahrhundert Peter Graf als Förderer der Tennis-Steffi traditionsgemäß an die Seite gestellt hat: „Er sah in ihr früh das ‚Wunderkind‘, das seine Tochter dank auch väterlicher Strenge tatsächlich werden sollte. […] Fortan war er auch der Manager seiner Tochter und übernahm ihre Geldgeschäfte und die Vermarktung“ (Schmitt 2013). Was hier im Nachruf auf den inzwischen verstorbenen Spezialisten des populären Saitenspiels mit Filzkugeln geschrieben steht, ließe sich ebenso über Friedrich Wieck berichten, dessen Tochter Clara mit ähnlichen Materialien ebenso virtuos umzugehen verstand und die sich beide erst durch eine gleichgesinnte Künstlerehe vom Vater lossagten und sich emanzipieren konnten. Das frühere Tennis-Wunderkind Jennifer Capriabi zerbrach am Drill ihres Vaters Stefano, French-Open-Siegerin Mary Pierce erwirkte vor Gericht, dass sich der cholerische Vater Jim ihr nicht mehr nähern durfte.
Blickt man auf den rhythmisierten Ganztag der Filzvirtuosen, scheint für Pianisten und Tennisakrobaten unbestritten, „dass Expertise als Hochleistung direkt mit dem Übungsaufwand korreliert“ (Oerter 2005, S. 217).
Dass ein müheloses Erreichen von musikalischen Höchstleistungen eine gern gezeugte Mär ist, die bis zur bewussten und väterlich verordneten Inszenierung einer entspannten Familienidylle reicht, zeigen die frühen Interviews mit einem gerade dem Wunderkindstatus entwachsenen David Garrett, etwa jenes mit Alfred Biolek (1997): „Meine Eltern haben mich immer zurückgehalten. […] Man arbeitet schon zwei drei Stunden. […] Wenn ich keine Lust habe, dann mach ich nichts“ [https://www.youtube.com/watch?v=yEmLOcL9U18]. Erst viel später brach die Wahrheit aus ihm heraus: „Ich habe acht Stunden am Tag geübt. Das ist kein Wunder. Das ist harte Arbeit“ (zit. nach Pirich 2013). Das Ende seiner Lebensphase als Wunderkind läuteten die Capriccen Paganinis ein. Garrett hatte als Sechzehnjähriger zwei im Repertoire, sollte alle vierundzwanzig aufnehmen. Schmerzende Arme waren kein Argument für den ehrgeizigen Vater und eine Mutter, die es als Ballerina gewohnt war, unter Schmerzen zu tanzen: „Er lebte ein Leben im Korsett. Üben, Konzert, Applaus, üben, Konzert, Applaus. Er hatte keine Freunde, er kannte nicht einmal andere Kinder“ (Pirich 2013). Nicht nur der Gendergerechtigkeit willen müssen den alleinerziehenden Vätern natürlich auch die Eislauf- und Bühnenmütter zur Seite gestellt werden. Ihnen allen gemein sind die Projektionen der eigenen, oft unerfüllt gebliebenen Wünsche und die Tatsache, ihr eigenes Wirken ganz in den Dienst ihrer Söhne und Töchter zu stellen, denn bereits im 18. Jahrhundert erforderten die notwendigen Präsentationspflichten ausgiebige Reisetätigkeiten von Turnier zu Turnier. Wer aus familiär schwierigen Verhältnissen stammte, hatte es weitaus schwerer im Leben. Diese fehlende Bildungsgerechtigkeit bekam etwa der junge Beethoven zu spüren, dem sich die komplizierten Familienverhältnisse zwischen einem trinkenden und lebensuntüchtigem Vater und dem übermächtigen Großvater, dem Hofkapellmeister Ludwig d. Ä. entgegenstellten: „Dieses junge Genie verdient Unterstützung, dass er reisen könnte. Er würde gewiss ein zweiter Wolfgang Amadeus Mozart werden, wenn er so fortschritte, wie er angefangen“ (zit. nach Bodsch 2003, S. 11), stellte sein Lehrer Christian Gottlob Neefe fest. Er sollte Recht behalten.

Musik zum Anbeten
Göttliche Züge wurden Beethoven aber eher posthum, eben durch das glorifizierende 19. Jahrhundert zugesprochen. Deutlich wird dies in einer bildlichen Darstellung seiner Geburt durch den Maler Friedrich Geselschap: Der kleine Beethoven wird von der Muse geküsst und wie der „wunderlich-göttliche Jesusknabe“ in die Wiege gelegt. Es gehört eben zum Arbeitsprofil einer Muse, die ihr zugewiesenen Künstler anzuspornen und zu inspirieren. Dem liegt die antike Vorstellung zu Grunde, dass Ideen (das Denken) von den Menschen nicht selbst entwickelt, sondern durch Götter und andere Assistenten von außen eingegeben werden. Kein Engelchor rahmt das Geschehen, aber vier singende Chorknaben, die hier Beethovens gottgleiche Herrlichkeit und eine das Übliche übertreffende Leis tungsexcellenz bereits im Säuglingsalter vorhergesehen haben, stehen der Krippe zur Seite. Und in weiser Voraussicht hält die ahnende Mutter eine Dornenkrone über des Göttersohnes Haupte. Ort des Geschehens ist nicht der Stall in Bethlehem, sondern das Geburtszimmer im Dachgeschoss der Bonngasse 20. Heute zeigt sich Erinnerungskultur an diesem Ort nüchterner, nämlich in einem zu huldigenden Gipsabdruck der berühmten Beethoven-Büste von Josef Danhauser. Anbetungsfreudige Wunderkindtouristen fehlen auf diesem Gemälde, das war bei Chris Tina Heineken anders. Hier war es der Pilger Georg Philipp Telemann, der zwar nicht aus dem Morgenland anreiste, aber doch eine beschwerliche Kutschfahrt von Hamburg nach Lübeck auf sich nahm und sich über den kleinen Christian durchaus huldigend äußerte: „Wahrlich, wäre ich ein Heide – ich würde meine Knie beugen und dieses Kind anbeten!“ (zit. nach Hennig 1999).

Wunderkind mit Ansage
Was sollte man aber nun über einen Vater denken, der bereits vor der Geburt seines Sohnes auf einer öffentlichen Pressekonferenz verkündet, der Welt bald ein noch zu gebärendes Wunderkind vorzustellen? Hier ist nicht vom Erzengel Gabriel die Rede, sondern von Leo Wiener, Professor an der ehrwürdigen Harvard University, der sich intensiv mit einem Buch des Pfarrers Karl Witte beschäftigt hat: In seinem zweibändigen Werk Karl Witte oder Erziehungs- und Bildungsgeschichte desselben hat dieser sich ausgiebig mit der hauptberuflichen Tätigkeit als Wunderkind-Erzieher seines Sohnes beschäftigt, der später als Dante-Forscher in die Wissenschaft einging, während die hier propagierten Erziehungsmethoden des Vaters in Deutschland stark kritisiert und schnell in Vergessenheit gerieten. Wundert es, dass Anfang des 20. Jahrhunderts gerade dieses Buch im Pisa-Eldorado China zu einem Bestseller wurde? Leo Wiener behauptete in seiner Pressekonferenz, die Konzeptionsfehler von Karl Witte Senior ausgemacht und erkannt zu haben, um dann selbst alles besser und noch richtiger zu machen. Da es in diesem präinklusiven Zeitalter noch keine individuellen Förderkonzepte gab, erlöste Vater Leo seinen Sohn von der Schule und nahm auf akribische Weise das Heft des Handelns selbst in die Hand. Dabei schien er ein großes pädagogisches Fingerspitzengefühl zu besitzen, zumindest, wenn man den autobiografischen Schilderungen seines Sohnes Glauben schenkt: „Meine Stunden endeten in einem Familienkrach. Vater tobte, ich weinte, und meine Mutter tat ihr Bestes, um mich zu verteidigen“ (zit. n. Kunze 2016, S. 51). Mit elf Jahren begann sein Sohn Norbert Mathematik zu studieren, er schloss mit 17 Jahren seine Dissertation ab, um dann im Erwachsenenalter mit seinen Forschungen zur automatischen Zielsteuerung von Flugabwehrgeschützen der Menschheit größtmöglichen Dienst zu erweisen. Doch all diese Geschichten können ein anderes Mal erzählt werden: Unter dem Pseudonym „Linda Quilt“ berichtet Hans Magnus Enzensberger in sieben Geschichten unter dem Titel „Schauderhafte Wunderkinder“ über Kinder mit Spezialbegabungen, die von Anpassung, Eigensinn, ungewollter oder geschickter Rebellion und der jeweils ganz besonderen Bürde sprechen. Ist es nicht auch irgendwie erleichternd, dass sich wunderkindliches Wirken eher auf Arbeitsgebiete beschränkt, die unserem Alltag enthoben scheinen und sie vornehmlich durch musikalisches Wirken auffallen, als große Rechenkünstler oder als begnadete Schachspieler auftreten? Gut, dass man bei Taxifahrern, Chirurgen und Politikern eher auf Erfahrung und normierte Ausbildungsregularien setzt.
Erfolg ist sicherlich kein Wunder
Es sollte deutlich geworden sein, wie sehr sich unsere heutige Musikkultur noch aus den Mythen des 18. und 19. Jahrhunderts nährt und Wundersames gerne mit Hilfe angeborener Dispositionen erklärt werden. Was wäre aus Mozarts DNA geworden, wenn sein Vater ein lehrwütiger Schachspieler gewesen wäre und er nicht in die Welt der Musik hineingewachsen wär? Aus dem Dilemma, dass erst eine musikalische Ausbildung zu gezeigten Leistungen führt, die dann im Umkehrschluss zur Diagnostizierung von Begabung herangezogen werden, kommt man nicht heraus. Musikalische Höchstleistungen sind nur im komplexen Zusammenspiel der verschiedensten Faktoren möglich. Das erklärt auch die unzähligen Dropouts, die trotz intensiver Mühen in entsprechenden Zeitfens tern nie Spitzenleistungen erreichen konnten: Im Zeit-Artikel Spielen bis zum Umfallen berichtet Nadja Kwapil über Spitzenbegabungen, die dem Druck der Probespiele nicht gewachsen waren: „In Clara Reinholds [Name geändert] Wohnung ziert wie ein Streifen mit Filmkadern eine lange Reihe von Fotos in viereckigen Bilderrahmen die Wände: Clara Reinhold lachend im roten Abendkleid, gerötete Wangen, rote Lippen, breites Lachen, strahlend weiße Zähne. Clara Reinhold im schwarzen Abendkleid, ihr Instrument in die Kamera haltend, ihre zarte Hand umfasst den Hals der Geige, als handle es sich dabei um ein erlegtes Tier. Clara Reinhold mit stolzen Eltern, Clara Reinhold mit einem noch stolzeren Lehrer. Doch das war einmal. Wie es nun weitergeht? Vielleicht wird sie etwas anderes studieren. So genau weiß sie es selbst noch nicht und findet das irgendwie angenehm“ (Kwapil 2012). Auf dem Weg zu ihrem 50. Probespiel brach die junge Geigerin zusammen, die Ärzte stellten Medikamenten- und Alkoholmissbrauch fest. Die Auffassung, dass es sich bei musikalischer Begabung um angeborene Fähigkeiten handelt, die wenig externe Anregungen für ihre Entfaltung brauchen, teilt heute wohl niemand mehr. Und doch müssen trotz aller Vorbehalte und der Verweis auf kulturelle Rahmungen und familiäre Dispositionen bestimmte genetische oder europhysiologische Bedingungen vorliegen, um frühe Auffälligkeiten und ein besonders schnelles Lernen zu erklären.